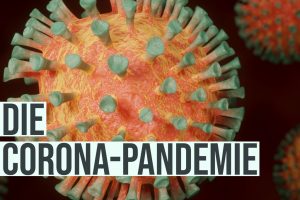Völlig losgelöst
Ich bin 15 Jahre alt und man sagt, ich gehöre zur Generation Internet. Ich habe nie gelernt, für Schularbeiten in Lexika zu recherchieren und habe auch nicht mit 12 angefangen, mein eigenes Kochbuch zusammenzustellen. Die Existenz von Computern, Handys, MP3-Playern und dem Internet ist für mich genauso normal wie Schnee im Winter und schlechte Noten in Mathe. Aber ist das Internet wirklich unentbehrlich? Zwei von drei Deutschen glauben dies. Vor 30 Jahren schrieb die Stiftung Warentest: „Wer auf die elektronische Aufrüstung seines Heimes verzichtet, büßt keine Lebensqualität ein.“ Ich möchte es selber herausfinden und habe beschlossen, die Zeit um gute 30 Jahre zurückzudrehen. Eine Woche ohne Internet und Smartphone.
Tag 1
Mitternacht.
Facebook – logout. ICQ-Messenger – abmelden. Skype – beenden. Weiteres Schließen von Registerkarten, schließlich das Schließen des gesamten Browsers. Das Löschen von sämtlichen, mit dem Web zusammenhängenden Symbolen von der Taskleiste. Das Entfernen jeglicher Internet- und SMS-Kacheln vom Startmenü des Handys. Adieu Kontakt zur Außenwelt. So startet mein kalter Entzug.
Ich weiß, das klingt alles ziemlich dramatisch. Als ob ich mich von der gesamten Menschheit abkoppeln würde. Ich fange an „Völlig losgelöst“ von Major Tom vor mich hin zu summen. Die Reise beginnt und mein Proviant für die kommenden sieben Tage sind einige Bücher, die ich schon immer mal lesen wollte, mein MP3-Player und ein paar Serien-DVDs. Das reicht zum „Überleben“, denke ich mir. Außerdem besteht ja auch noch ein Kontakt zur Außenwelt. Ein Festnetztelefon. Beruhigt gehe ich ins Bett und schlafe bald ein.
Immer noch Tag 1
An meinem ersten Tag mit Internetabstinenz verschlafe ich prompt. Normalerweise weckt mich mein Webradio pünktlich mit meiner Lieblingsmusik. Kaum habe ich einen vorwurfsvollen Blick Richtung Laptop geworfen, als mir meine selbstauferlegte Internetenthaltsamkeit in den Kopf schießt. Verschlafen ist auf meiner Relevanzskala für Facebookmeldungen mit „hoch“ einzustufen und würde im Normalfall nun als erste Nachricht des Tages auf meiner Pinnwand stehen. Wie furchtbar banal doch das Internet sein kann. Ständig lese ich Statusmeldungen von Freunden, die darüber berichten, dass sie heute shoppen gehen, Pizza zum Mittag essen oder sich zum Fußballgucken mit den Kumpels treffen. Und auch ich stimme regelmäßig mit ein in den Chor der Belanglosigkeiten. Dennoch kann man aus diesen Banalitäten etwas ableiten. Der Journalist Clive Thompson nennt dieses Phänomen „Ambient Awareness“. Dieser Begriff ist in etwa mit „Umgebungswahrnehmung“ zu übersetzen. Thompson beschreibt, dass wir im Unterbewusstsein die vielen kleinen, banalen Informationen, die wir von unseren Freunden via Facebook, Twitter und Co. tagtäglich erhalten, in unserem Kopf zu einem großen Gesamtbild zusammensetzen und somit einen ziemlich guten Eindruck vom wirklichen Charakter einer Person bekommen. Nun ja, zumindest so wirklich, wie die Aufrichtigkeit im Netz nun mal sein kann. Es wird wohl kaum jemand schreiben, dass er morgen Abend wieder seine Freundin betrügen wird.
Normalerweise ist es nun die Zeit, in der ich mich auf wetter.de erkundige, wie es heute draußen werden soll, aber ein Blick aus dem Fenster in den strömenden Regen verrät mir das Gleiche. Wie oldschool.
Tag 2
 Heute war ich schlauer und habe mich von einem Wecker aus dem Schlaf reißen lassen. Nachdem ich den ersten Tag recht gut überstanden habe, fühlt sich der Beginn des zweiten Tages schon nicht mehr so gut an. In mir wächst die Angst. Die Angst etwas zu verpassen! Die digitale Welt hat sich seit meinem Ausstieg mit dem gleichen hohen Tempo weitergedreht und kaum jemandem wird aufgefallen sein, dass ich nichts mehr poste. Und da ich überlebenswichtige Informationen, zum Beispiel über das Liebesleben meines Umkreises, brauche, greife ich zu Plan B über: Ich besuche meine Freundin, welche ihre Ausbildung gerade beim Friseur macht, und lasse mich von ihr auf den neusten Stand bringen. Außerdem sind meine Spitzen schon längst überfällig und müssen wieder geschnitten werden,
Heute war ich schlauer und habe mich von einem Wecker aus dem Schlaf reißen lassen. Nachdem ich den ersten Tag recht gut überstanden habe, fühlt sich der Beginn des zweiten Tages schon nicht mehr so gut an. In mir wächst die Angst. Die Angst etwas zu verpassen! Die digitale Welt hat sich seit meinem Ausstieg mit dem gleichen hohen Tempo weitergedreht und kaum jemandem wird aufgefallen sein, dass ich nichts mehr poste. Und da ich überlebenswichtige Informationen, zum Beispiel über das Liebesleben meines Umkreises, brauche, greife ich zu Plan B über: Ich besuche meine Freundin, welche ihre Ausbildung gerade beim Friseur macht, und lasse mich von ihr auf den neusten Stand bringen. Außerdem sind meine Spitzen schon längst überfällig und müssen wieder geschnitten werden,
Ich greife also zum Festnetztelefon um einen Termin abzusprechen und mir fällt ein, dass ich die Nummer nicht kenne. Nachdem ich den „Google“ Ruf meines Hirns wohlwollend überhört habe, frage ich meine Mutter nach einem Telefonbuch. Meine Mutter schaut mich an, als hätte ich sie gerade nach einer handgeschriebenen Bibel aus dem Mittelalter gefragt und antwortet dann: „Ich habe es weggeworfen, das lag hier immer nur rum und keiner schaute rein.“
Wagemutig entschließe ich mich also dazu, 40 Minuten zu Fuß zum Friseur zu laufen, da mein Fahrrad glücklicherweise einen Platten hat. Dort erfahre ich, dass es für heute leider keinen freien Termin mehr gibt und Lina im Übrigen schon den zweiten Tag krankgeschrieben ist. „Am besten, Sie vereinbaren vorher telefonisch einen Termin“, so der kluge Ratschlag einer Angestellten. „Oh Danke, warum bin ich darauf nicht selber gekommen?“ entfährt es mir mit einem ironischen Unterton, der jedoch von meinem Gegenüber überaus souverän weggelächelt und wahrscheinlich auch nicht als solcher wahrgenommen wird. Als mir auf meinem Nachhauseweg die ersten Regentropfen aufs Gesicht fallen, verfluche ich meinen Selbstversuch zum ersten Mal.
Tag 3
Nach meinem gestrigen Friseurdesaster habe ich ein anderes Informations-Methadon gefunden: die regionale Tageszeitung. Ich sitze am Küchentisch, blättere mich durch die ersten Seiten und komme mir dabei plötzlich so verdammt erwachsen vor. Kaum ein Jugendlicher in meinem Alter liest regelmäßig die Tageszeitung. Und auch die Erwachsenen greifen immer seltener zu gedruckten Informationen. Das Aussterben der Printmedien hat begonnen.
 Die Auswahl der Nachrichten trifft nicht meine Interessen und ich blättere weiter zum Regionalteil. Dort erfahre ich, dass der örtliche Kindergarten am Wochenende einen Basar veranstaltet, dass der Männergesangsverein einen neuen Vorstand gewählt hat und dass der Wildbestand der Region alarmierend zurückgeht.
Die Auswahl der Nachrichten trifft nicht meine Interessen und ich blättere weiter zum Regionalteil. Dort erfahre ich, dass der örtliche Kindergarten am Wochenende einen Basar veranstaltet, dass der Männergesangsverein einen neuen Vorstand gewählt hat und dass der Wildbestand der Region alarmierend zurückgeht.
Auch meine Langeweile erreicht einen alarmierenden Zustand. Ein wenig Aufheiterung erfahre ich, als ich schließlich die Seite mit den Geburtsanzeigen erreiche. Michelle-Malou wurde geboren und ist fortan die kleine Schwester von Mia-Joly. Der Chantalismus hat ein neues Opfer gefunden. Dies wäre eigentlich der Moment, in dem ich bei Google nach den zehn dämlichsten Vornamen der Welt suchen würde, doch dieser Spaß bleibt mir leider verwehrt.
Tag 4
Ich habe heute meine ehemalige Nachbarin Ille besucht. Sie ist inzwischen über 70 und für mich eine Art Zweit-Oma geworden. Sie verwöhnt mich mit Keksen und erzählt mir Geschichten aus ihrer Jugend. Sie gehörte zur ersten Generation, welche mit Computern arbeiten durften. Und die ersten Computer waren nicht etwa, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, alte, weiße Kisten mit Gameboy-Grafik. Es waren bildschirmlose Geräte ohne Tastatur, groß wie ein Schrank und mit Knöpfen mit denen man durch eine bestimmte Kombination Befehle ausüben konnte. Heute steckt in jedem Smartphone mehr Rechenleistung, als für die erste Mondlandung zur Verfügung stand.
Mein Blick streift durch Illes Wohnzimmer und bleibt an einem Bücherregal aus deutscher Eiche hängen. Dort steht er, das Googlependant der 80er Jahre, der Brockhaus. 24 Bände, in Leder gebunden, mit Goldschnitt. Das gesammelte Wissen der Menschheit in seiner ästhetischsten Form. „Ach, du hast den alten Staubfänger entdeckt“, sagt Ille, als sie mit einer Kanne Tee zurück ins Wohnzimmer kommt. „Es hat über 4 Jahre gedauert und über 3000 DM gekostet, bis wir alle Bände zusammen hatten. Und jetzt nimmt er mir nur den Platz weg.“ Vier Jahre – im Internetzeitalter sind das Lichtjahre. Die deutschsprachige Wikipedia Ausgabe verzeichnete 2012 ca. 500 neue Artikel pro Tag und hat inzwischen mehr als 1,5 Millionen Artikel. Der Brockhaus schafft es auf knapp über 300.000. Da wundert es nicht, dass man heutzutage nicht mehr brockhaust sondern nur noch googelt und Wikipedia befragt. Während uns der Brockhaus auf eine Frage eine Antwort liefert, haben wir uns daran gewöhnt, dass wir statt einer Antwort viele verschiedene Antworten finden. Aus diesen müssen wir die wahrscheinlichste Version ableiten und die unglaubwürdigen aussortieren. Wissen wird nicht in Leder gebunden sondern erscheint plötzlich austauschbar. Verlernen wir immer mehr selber nachzudenken, macht uns Google dumm? Das behauptet zumindest der Psychiater Manfred Spitzer. Seiner Ansicht nach prägen sich die Menschen heutzutage immer weniger Informationen ein, denn sie wissen, dass sie die Informationen bei Bedarf einfach wieder googeln können. Spitzer nennt dieses Phänomen auch digitale Demenz. Dank Google verblödet die Menschheit? Nicht, wenn Kinder lernen, die Funktionsweise einer Suchmaschine zu verstehen.
 Google liefert uns inzwischen nicht nur Antworten auf unsere Fragen, sondern vervollständigt inzwischen auch unsere Suchanfragen von alleine. Nicht immer beweist es dabei Geschick. Gibt man z.B. die Worte „Kann man…“ in die Suchleiste ein, so schlägt Google „Kann man Käse einfrieren“, „Kann man Tee rauchen“, „Kann man mit dem IPad telefonieren“ und „Kann man eine Meerjungfrau werden“ als Suchanfragen vor. Fragen, die unsere Welt bewegen.
Google liefert uns inzwischen nicht nur Antworten auf unsere Fragen, sondern vervollständigt inzwischen auch unsere Suchanfragen von alleine. Nicht immer beweist es dabei Geschick. Gibt man z.B. die Worte „Kann man…“ in die Suchleiste ein, so schlägt Google „Kann man Käse einfrieren“, „Kann man Tee rauchen“, „Kann man mit dem IPad telefonieren“ und „Kann man eine Meerjungfrau werden“ als Suchanfragen vor. Fragen, die unsere Welt bewegen.
Als mir Ille noch ein Fotoalbum von früher zeigt, werde ich melancholisch. Die vergilbten Seiten, das knisternde Papier und die schon leicht ausgeblichenen Fotos zeugen von glücklichen und erfüllten Jahren. Dieses Album ist die Chronik eines Lebens und es ist ein wertvoller Erinnerungsschatz. Meine Gedanken schweifen in die Zukunft. Werde ich in 60 Jahren mit meine Enkeln vor einem Bildschirm sitzen und mit ihnen durch meine Facebook Timeline scrollen. Welches Bild werden sie dann von ihrer Oma bekommen? Ich sollte mir gut überlegen, welche Spuren ich im Netz für die nächsten Generationen hinterlasse.
Tag 5
Heute habe ich mich dazu entschlossen, mich mit meiner Freundin Jessica in einem Eiscafé zu verabreden. Über ein kurzes Festnetz-Telefonat klären wir ab, wie spät wir uns dort treffen. Sie spricht es nicht aus, doch scheint sie leicht verwirrt zu sein, warum ich sie nicht einfach ansimse.
Als ich einige Stunden später das Haus verlasse, mache ich ein paar routinierte Handgriffe. Der Haustürschlüssel ist in der linken Hosentasche, das Portemonnaie in der Jacke und das Handy. Wo ist das Handy? Normalerweise befände es sich jetzt in meiner rechten Hosentasche. Nun liegt es in meinem Zimmer auf dem Schreibtisch. Ich fühle mich beinahe nackt, ohne Handy aus dem Haus zu gehen, aber bevor ich weiter ins Grübeln komme, ziehe ich die Haustür hinter mir zu. Da die Eisdiele direkt ein paar Straßen weiter liegt, bin ich nach 5 Minuten da und warte auf Jessica, welche sich wie immer zu verspäten scheint. Normalerweise bekomme ich immer eine knappe SMS mit dem Grund für ihre Verspätung, ihren überaus problematischen Haaren zum Beipiel. Ohne Handy und ohne Ahnung, wo sie bleibt, fühlt sich jede Minute schrecklich an und kriecht nur in Zeitlupe dahin.
 Als endlich die Glocke über der Eingangstür läutet, meine Freundin den Laden betritt und sich zu mir an den Tisch setzt, habe ich mir schon einen Eisbecher ausgesucht und spiele an meinem Schlüsselanhänger herum. „Hi, na Du, ich muss nur noch kurz die Nachricht zu Ende tippen!“, begrüßt sie mich. „Kein Ding“, sage ich und reiche ihr die Eiskarte rüber. Als Jessica fertig ist, legt sie ihr Handy auf den Tisch und berichtet, dass sie nur kurz wissen wolle, wie es ihrem Freund gehe, der für 6 Tage auf einer Klassenfahrt sei. „Und, wie geht es ihm?“ „Na ja, er meldet sich nicht so oft. Er hat bestimmt schlechten Empfang!“ Ich bemerke ihren beunruhigten Unterton in der Stimme und versuche sie mit einem überzeugend klingenden „Bestimmt!“ zu beruhigen. Es gelingt mir nur mäßig. Viele Paare glauben, dass sich die räumliche Distanz durch die ständige Erreichbarkeit via Handy aufheben lasse. Dabei zerstört ein dauerhaftes Miteinander, und sei es auch nur virtuell, ziemlich schnell den Reiz des anderen. Nachrichten werden im Minutentakt ausgetauscht, doch mit der steigenden Quantität sinkt oft die Qualität der Nachrichten. Statt gefühlvoller Worte sorgen belangloses Blabla oder ein kontrollierendes „Wo bist du gerade?“ schon nach kurzer Zeit für gereizte Nerven.
Als endlich die Glocke über der Eingangstür läutet, meine Freundin den Laden betritt und sich zu mir an den Tisch setzt, habe ich mir schon einen Eisbecher ausgesucht und spiele an meinem Schlüsselanhänger herum. „Hi, na Du, ich muss nur noch kurz die Nachricht zu Ende tippen!“, begrüßt sie mich. „Kein Ding“, sage ich und reiche ihr die Eiskarte rüber. Als Jessica fertig ist, legt sie ihr Handy auf den Tisch und berichtet, dass sie nur kurz wissen wolle, wie es ihrem Freund gehe, der für 6 Tage auf einer Klassenfahrt sei. „Und, wie geht es ihm?“ „Na ja, er meldet sich nicht so oft. Er hat bestimmt schlechten Empfang!“ Ich bemerke ihren beunruhigten Unterton in der Stimme und versuche sie mit einem überzeugend klingenden „Bestimmt!“ zu beruhigen. Es gelingt mir nur mäßig. Viele Paare glauben, dass sich die räumliche Distanz durch die ständige Erreichbarkeit via Handy aufheben lasse. Dabei zerstört ein dauerhaftes Miteinander, und sei es auch nur virtuell, ziemlich schnell den Reiz des anderen. Nachrichten werden im Minutentakt ausgetauscht, doch mit der steigenden Quantität sinkt oft die Qualität der Nachrichten. Statt gefühlvoller Worte sorgen belangloses Blabla oder ein kontrollierendes „Wo bist du gerade?“ schon nach kurzer Zeit für gereizte Nerven.
Während ich mich genüsslich meinem Waldbeer-Becher widme, bemerke ich, dass Jessica dauerhaft mit mindestens einem Auge auf ihr Smartphone schielt und immer wieder unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutscht. „Ich finde dein Experiment ziemlich cool“, sagt sie schließlich. „Zwei Wochen komme ich ohne Sven wohl aus, aber eine Woche ohne Internet – ich würde durchdrehen!“ Mit dieser Prioritätenverteilung ist meine Freundin in guter Gesellschaft: Nach einer Umfrage des Marktforschungsunternehmens Harris Interactive findet fast jeder dritte Mann und jede zweite Frau das Internet wichtiger als Sex. Und wenn die Beziehung dann doch irgendwann in die Brüche geht, ist die Auswahl an potenziellen Nachfolgern im Internet riesig. Doch das macht es nicht unbedingt leichter. Fast 10 Minuten habe ich gebraucht, um mir aus der großen Auswahl mit über 30 verschiedenen Eisbechern mein Eis auszusuchen. Würden nur 6 Becher auf der Karte stehe, hätte ich mich schneller entschieden. Ich hasse das Gefühl mich für irgendetwas entscheiden zu müssen, wenn ich vielleicht auch etwas Besseres finden kann. Wer die Wahl hat, hat die Qual.
Das Piepen von Jessicas Handy unterbricht unser Gespräch abrupt. Innerhalb einer Sekunde ist ihr Eis vergessen und sie hält ihr Smartphone in der Hand. Als ein Lächeln über ihr Gesicht huscht, weiß ich, dass Sven geantwortet hat. „Na endlich“, sagt sie, „wurde aber auch Zeit.“ Zwanzig Minuten können bei ständiger Erreichbarkeit eine Ewigkeit sein.
Tag 6
In einer Woche habe ich Geburtstag und ich muss unbedingt noch meine Freunde zu meiner Feier einladen. Schnell gemacht: Auf Facebook eine Veranstaltung erstellen, Freunde aus der Liste auswählen und innerhalb der nächsten 2-3 Stunden haben die meisten die Einladung bestätigt. Da ich aber eine vorbildliche Offlinerin bin, muss ich mir etwas anderes überlegen. Als erster Gedanke kommen mir persönliche, handgeschriebene Einladungen in den Sinn. Ich fahre also zum nächsten Schreibwarengeschäft und muss resigniert feststellen, dass sie nur Briefpapier für Hochzeiten und Beerdigungen führen. Scheinbar sind dies die einzigen verbliebenen Ereignisse, zu denen man noch klassisch per Brief einlädt. Wäre es eigentlich pietätlos, wenn man per Mail zu einer Beerdigung eingeladen werden würde? Ich würde wohl trotzdem hingehen. Da ich die Vorstellung sowieso ziemlich abschreckend finde, einen ganzen Tag dafür zu opfern, um 35 Einladungskarten zu schreiben, entscheide ich mich notgedrungen für die leichtere und vor allem schnellere Methode und rufe meine Freundin an. Nachdem ich sie über mein Experiment aufgeklärt habe, erstellt sie fix eine Veranstaltung, lädt die von mir genannten Gäste ein und macht sich sogar die Mühe, den Leuten, mit denen sie nicht befreundet ist, eine Freundschaftsanfrage zu schicken, um sie zu dem Event hinzufügen zu können. Drei Stunden später ruft sie mich dann erneut an und teilt mir mit, dass fast alle Gäste bereits auf „teilnehmen“ geklickt haben.
Tag 7
 Der letzte Tag meines Experiments ist angebrochen und langsam hähere ich mich dem Ende meiner Reise. Ich bin vor einer Woche aufgebrochen, um eine analoge Welt zu entdecken und im sogenannten Real Life anzukommen. Beim Rückblick auf die vergangenen Tage habe ich festgestellt, dass das Digitale und die analoge Welt keine getrennten Räume, sondern miteinander verwoben, also eins sind. Auch das Internet ist echt, es ist ein Teil der Wirklichkeit.
Der letzte Tag meines Experiments ist angebrochen und langsam hähere ich mich dem Ende meiner Reise. Ich bin vor einer Woche aufgebrochen, um eine analoge Welt zu entdecken und im sogenannten Real Life anzukommen. Beim Rückblick auf die vergangenen Tage habe ich festgestellt, dass das Digitale und die analoge Welt keine getrennten Räume, sondern miteinander verwoben, also eins sind. Auch das Internet ist echt, es ist ein Teil der Wirklichkeit.
Eine meiner Haupterkenntnisse der letzten sieben Tage ist jedoch, dass das eigene Privatleben früher, zu der Zeit, als es einfach noch keine virtuelle Welt gab, in vielen Hinsichten leichter gewesen sein muss. Damals hatte man keinen Streit mit seinen Freundinnen, weil man ihr neues Profilbild in Facebook nicht geliked oder ihnen in Whatsapp auf die wohl am meisten gestellte Frage der Welt „Wie geht’s?“ nicht geantwortet hatte, obwohl die zwei kleinen Häkchen anzeigten, dass die Nachricht vom Empfänger gesehen wurde. Damals konnte man seine ganzen Freunde an einer Hand abzählen und brauchte sich nicht zu wundern, wenn man von Unbekannten angechattet wurde, weil man sie so wie weitere 641 Personen in seiner Kontaktliste stehen hatte. Hatte früher jeder sein persönliches Hobby, sei es das Zeichnen, Tanzen, Handarbeiten, Schreiben, Musizieren oder die Arbeit mit Tieren, so verschwenden heute viele Jugendliche ihre Zeit vor ihren Handys, iPods und Laptops. Allerdings kann ich nicht feststellen, dass das Internet uns grundsätzlich dümmer oder schlauer macht. Auch das Radio, Fernsehen, Zeitschriften oder Bücher machen uns nicht automatisch dumm oder schlau. Es kommt immer auf die Inhalte an und darauf, wie wir sie nutzen.
Analoge Ignoranz wird uns im 21. Jahrhundert nicht voranbringen. Die Frage nach ‘Internet ja oder nein‘ kann nicht ernsthaft gestellt werden, denn es grenzt an Utopie, sich dem Internet gänzlich entziehen zu wollen. Das Internet ist mit der heutigen und zukünftigen Welt untrennbar verbunden. Noch nie war die Kommunikation zwischen Menschen so schnell und effektiv und dank des Internets rückt die Welt näher zusammen und lernt sich so auch hoffentlich besser kennen und verstehen.
Als ich mich am Abend zum ersten Mal wieder bei Facebook einlogge, summe ich wieder ein Lied. Dieses Mal ist es Westernhagen: Ich bin wieder hier, in meinem Revier. Ich atme tief ein und dann bin ich mir sicher, wieder zuhause zu sein.
Titebild: fotolia.de